Hauptteile eines Fischgehirns:
- Tractus olfactorius (verschaltet Impulse vom Geruchsorganorgan mit Geruchszentrum im Telencephalon (Großhirn)
- Telencephalon (Großhirn, auch Vorderhirn)
- Vorderhirn (Telencaphalon)
- Zwischenhirn (Diencephalon)
- Mittelhirn (Mesencephalon)
- Hinterhirn (Metencephalon)
- Nachhirn dass ins Rückenmark mündet (Myelencephalon)
- Bildung des Hirnstamms aus ventralen Teil von Mittel-, Hinter- und Nachhirn (vegetative Funktion und motorische Reflexzentren, Ursprung aller Gehirnnerven außer Seh- und Riechnerv )
- Bildung des Kleinhirns vom dorsalen Teil des Hinterhirns und ist relativ groß (Bewegungssteuerung und Gleichgewichtssinn)
- Mittelhirndach = Seh- und Hörzentrum
- Lage des Hypothalamus und der Epiphyse (Pinealorgan) im Zwischenhirn (Steuerungszentrum aller vegetativen Prozesse, Verhaltensweisen, Hormonregulation)
- im Vorderhirn befindet sich vor allem das Riechhirn
- Form und Größe unterscheidet sich nach Art
Evolution von Lunge und Schwimmblase
- Entwicklung eines zusätzlichen respiratorischen Epithels im Vorderdarm (Blindsack)
- besser vor Austrocknung geschützt
- kann athmosphärische Luft atmen
- Weiterentwicklung des Blindsacks zur Schwimmblase (bei Knochenfischen) und zur Lunge (bei Landwirbeltieren und Muskelflossern (als zusätzliches Atemorgan))
Schwimmblase:
-
Funktion:
- Anpassung des spezifischen Gewichts an die Wasserumgebung -> freies schweben (Vorteil im Süßgewässer aufgrund der geringen Wasserdichte und Schweben energiesparender)
- Verlagerung des Körperschwerpunktes durch füllen eines der beiden Luftsäcke durch Gas (z.B. Luft schnappen, Gassekretion/-resorption)
- Physostomen: behalten Verbindung der Luftblase zum Darm; Gasregulation durch Darm
- Physodisten:reduzieren Verbindung der Luftblase zum Darm
- Luftblase = geschlossener Luftsack und benötigt andere Machanismen zur Gasregulation (Gasresorption und Gassekretion)
- Schwimmblase von Kapillarnetz umgeben -> Füllen und Leeren der Blase mit CO2, O2 und N2 (analog Lunge)
-
Form:
- Einkammerig mit Luftgang; Vorkommen: Samlmoniden, Hecht, Aal
- Geschlossen, mit Oval und Gasdrüse; Vorkommen: Barschartige, Dorschartige, Stichling
- Zweikammerig, mit Luftgang; Vorkommen: Cypriniden
- mit 2 Luftgängen; Vorkommen: Heringe
Lunge:
-
Lungenfische:
- Form eines strukturlosen Sacks
- Lunge einfach gekammert und mit Kapillarnetz umgeben
- (zusätzliche Kiemenatmung im Wasser)
-
Amphibien:
- Einsetzen einer leichten Einfaltung der Lungenwände
- Lunge besteht aus 2 Kammern
- (zusätzliche Hautatmung)
-
Reptilien:
- starke Einfaltung der Lungenwände aufgrund höheren O2-Bedarfs durch höherer Aktivität bei warmen Temperaturen (wechselwarm)
- Wegfall der Hautatmung (Schutz der Haut vor Austrocknung durch Panzer) und Kiemenatmung (weitere Entfernung vom Wasser)
- Atmung durch erzeugen eines Unterdrucks durch Ausdehnung des Brustkorbs
-
Säugetiere
- quantitative Verbesserung der Reptilienlunge durch höhere Stoffwechselrate (höhere Aktivität)
- weitere Kammerung (Lungenlappen) der Lunge und Vergrößerung der respiratorischen Oberfläche (Lungenbläschen)
- Verzweigung der Luftröhre zu Bronchien
- Trennung von arteriellem (O2-reich) und venösem (CO2-reich) Blut durch verbesserten Blutkreislauf
- Verbesserung der Luftventilation durch Entwicklung des Zwerchfells
-
Vogellunge
- Entwicklung von Luftsäcken
- unbeweglich und nicht gelappt
- Entwicklung von Bronchien, die in zahlreichen Neben- und Parabronchien, dünnwandige Luftröhrchen und Luftkapillaren enden
- Luftstrom fließt sowohl beim ein, als auch beim ausatmen durch Lunge (höhere O2 Ausschöpfung)
Seitenlinienorgan:
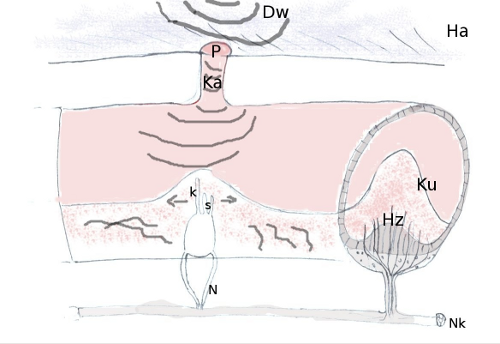
|
Dw:Druckwelle P:Pore Ka:Kanal Ha:Hautoberfläche Ku:Kupula Hz:Harzelle mit Neuromasten Nk:Nervenkanal N:Nerven k:Kinozilie s:Stereozilie |
- Sinnesorgan zur Wahrnehmung der Wasserströmung und chemischer Reize (Ortung und Erkennung von Feinden, Beute und Artgenossen =Ferntastsinn)
- Porenreihe entlang der gesamten Körperlänge beginnend hinter dem Kiemendeckel
- bestehen aus Epidermal- und Kanalneuromasten
- Neuromasten: fingerförmige mit Cilien besetzte und mit einer Gallerte (Cupula) umgebene Zellen, die durch die Haut ins Wasser ragen; am Ende der Cilien befinden sich Nervenzellen d
- urch Wasserdruckwellen wird Gallerte bewegt und Cilien in bestimmte Richtungen (je nach Reiz) gebogen
-
Besonderheiten:
- Schwarmfische ertasten Abstand und Schwimmrichtung der Nachbarfisches und Anwesenheit eventueller Feinde
- bei wandernden Fischen wurde während der Evolution das Seitenlinienorgan zu Elektrorezeptoren -> dient zur geomagnetischen Navigation am Erdmagnetfeld
- bei Haien befinden sich Elektrorezeptoren im Kopfbereich, wodurch sie selbst im Sand vergrabene Beute orten können
Szenario für den Landgang der Schädeltiere:
Selektionsdruck:
- O2-Mangel in warmen Gewässern
- Flucht vor Feinden
- Nahrungsmangel im Wasser, Nahrungsreichtum an Land
- Übervölkerung
- "Drang zur Ausbreitung"
Voraussetzungen:
- primitive Fische gingen wenigstens kurzzeitig an Land mussten an Land atmen können mussten sich etwas fortbewegen können
- -> Quastenflosser hatten fleischige Brustflossen im Gegensatz zu den Lungenfischen -> besseren Voraussetzungen an Land zu gehen -> haben sich die Vorfahren der Amphibien entwickelt
- fleischigen Brustflossen ermöglichten kurzzeitigen Landgang -> großer Vorteil herausgestellt bei der Nahrungsversorgung durch Kleinsttiere an Land
- O2-Versorgung an Land sehr schlecht (Hauptatemorgan weiterhin Kiemen)
- Lunge war nur sackartig und wenig effektiv
- CO2-Abgabe an Land großes Problem: Kiemen an Land nicht effektiv genug ->starker Selektionsdruck zur Verbesserung der CO2-Abgabe an Land -> Gesteigerte Permeabilität der Haut, Nieren schieden mehr Bicarbonat aus
- die Haut wurde aber wesentlich permeabler -> Nachteil im Wasser -> Wasser strömt in den Körper ein -> Tier drohte zu platzen an Land zu hoher Wasserverlust
- Entwicklung eines neuen Hauttyps -> für Gase relativ gut permeablel, für Wasser aber weniger (möglichst wenig Porine)
- regelmäßiger Wechsel zwischen den Medien
- verbesserte Ventilation der Lunge
- -> Amphibien entwickelten drei Atmungsorgane: Kiemen, Lungen, Haut
- Stickstoffausscheidung bei Fischen im Wasser über Kiemen in Form von NH3 NH3 sehr giftig -> keine Abgabe über Lunge oder Haut möglich
- -> Ausscheidung verschiedener Aminosäuren über die Nieren -> Exkretion in Form von Harnstoff (aus CO2 und NH3 wird in Leber Harnstoff synthetisiert, über Niere ausgeschieden)
- Amphibien auf nahe Gewässer angewiesen; Wechsel zwischen Land- und Wasseraufenthalt
- Schwerkraft -> Stabilität der fleischigen Brustflossen gering -> weitere Entwicklung führte zur Stabilisierung
weitere Probleme:
- Austrocknung
- neuartige Feinde
- eingeschränkte Sehfähigkeit
- Seitenlinienorgan fällt für die Orientierung an Land aus
- An eine Fortpflanzung an Land war bei den ersten Amphibien nicht zu denken